Die Fortschritte bei der Entschlüsselung des Entstehens der Alzheimer-Erkrankung tragen zu einem neuen Verständnis bei: Nachdem sich die Krankheit lange vor dem Auftreten klinischer Symptome entwickelt, müsse dieser „stummen“ Phase besondere Aufmerksamkeit gelten, betonen Experten. Das auch, weil bis 2025 mit der Verfügbarkeit von Therapien gerechnet wird, die in das Krankheitsgeschehen eingreifen und das Auftreten klinischer Symptome verhindern oder zumindest verzögern sollen. Erheblichen Nachholbedarf sehen Experten in Österreich bei der Unterstützung betreuender Angehöriger und bei einer angemessenen Einstufung für den Pflegegeld-Bezug.
Die „stumme“ Phase als Schlüssel zur Früherkennung

Der oft viele Jahre andauernden „stummen“ Phase der Alzheimer-Erkrankung, in der pathologische Veränderungen nachweisbar sind, aber noch keine klinischen Symptome auftreten, muss besondere Aufmerksamkeit gelten. Denn sie ist der Schlüssel zu Früherkennung und effektiven Therapien. Für betreuende Angehörige ist angesichts der massiven Belastung mehr Unterstützung erforderlich. Ebens eine Sensibilisierung und Schulung von Pflegegeld-Gutachtern, damit angesichts Krankheits-spezifischer Besonderheiten die Einstufung auch dem tatsächlichen Betreuungsbedarf entspricht.
Gemessen an DALYs, einer Messgröße für die durch Krankheit und vorzeitigen Tod verlorenen Lebensjahre, liegen Demenz-Erkrankungen mit insgesamt 28 Millionen DALYs 2016 in absoluten Zahlen bereits unter den Top 3 der neurologischen Erkrankungen, was die globale Krankheitslast betrifft – hinter Schlaganfall (116 Millionen) und Migräne (45 Millionen). Wobei Demenzen besonders steile Zuwachskurven aufweisen, mit einem Plus von 37,5 Prozent seit 2006 und von sogar 120,8 Prozent seit 1990. Das zeigen die vor wenigen Tagen veröffentlichten Daten der neuen „Global Burden of Disease„-Studie (in Englisch). Alzheimer ist mit bis zu 70 Prozent der Fälle die häufigste Form dementieller Erkrankungen.
230.000 Morbus Alzheimer Erkrankte bis 2050 in Österreich
Die Wissenschaft entschlüsselt immer besser das Entstehen der Alzheimer-Erkrankung, was auch zu einer Neuorientierung bei der Krankheitsdefinition führt. Erst kürzlich hat ein internationales Forscherkonsortium in einer Publikation (in Englisch) dafür plädiert, sich bei Morbus Alzheimer vom Konzept klar definierter Krankheitsstadien zu verabschieden. Vielmehr müsse die Erkrankung als ein vielfältiger und facettenreicher Prozess im Sinne eines biologischen und klinischen Kontinuums verstanden werden.
Dieses Konzept des Kontinuums ist auch für die Entwicklung effektiver Krankheits-modifizierender Therapien entscheidend. Der Krankheits-Prozess kann über 20 Jahre oder mehr andauern. Dabei verläuft er von einer symptomfreien Phase über eine lange präklinische Phase, in der die pathologischen Veränderungen über Biomarker nachweisbar sind, ohne dass es zu klinischen Symptomen kommt, bis hin zur klinischen Phase mit typischen Symptome von kognitiven und funktionellen Beeinträchtigungen. Aus gutem Grund lenkt die Alzheimer-Forschung ihr Interesse insbesondere auf die „stumme“ Phase des Krankheitsgeschehens. Vorrangig ist die Frage, wie in genau diese am besten eingegriffen werden kann, um eine weitere Entwicklung des Krankheitsgeschehens zu verhindern oder zumindest zu verzögern.
Wichtige Beiträge durch Biomarker
Von Interesse ist hier auch, warum es nicht bei allen Menschen, die für Alzheimer typische pathologische Veränderungen im Gehirn aufweisen, auch tatsächlich zu klinischen Symptomen kommt. Wichtige Beiträge liefern hier unter anderem Fortschritte bei den Biomarkern. So werden etwa mit MRT oder PET-Untersuchungen Amyloid-Ablagerungen in Gehirn sichtbar gemacht, das Eiweiß ist ein typischer Biomarker für Alzheimer. Auch Untersuchungen der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit können Aufschluss über das Vorliegen pathologischer Veränderungen mit hohem Alzheimerrisiko geben. Führende Alzheimer-Spezialisten gehen davon aus, dass bis 2025 tatsächlich neue Therapien verfügbar sein werden.
Fortschritte bei der Entschlüsselung relevanter Genmutationen

Zunehmend werden auch Gen-Mutationen entschlüsselt, die das Risiko beeinflussen, eine Alzheimer-Erkrankung zu entwickeln. Erst kürzlich wurde eine groß angelegte internationale Studie (in Englisch) mehrerer Forschungskonsortien publiziert. Darin konnten drei neue Genmutationen beschrieben werden, die das Risiko für eine Alzheimer-Erkrankung beeinflussen. Diese seltenen Varianten, die auf eine kausale Rolle von Mikrogliazellen und somit Immunzellen im Gehirn für die Alzheimer-Erkrankung hinweisen, könnten auch gute Ansatzpunkte für neue Therapien liefern. Darüber hinaus konnten auch andere Gene und Proteine identifiziert werden, die als Netzwerk eine wichtige Rolle im Krankheitsgeschehen spielen dürften.
Wichtige Impulse für die Erforschung genetischer Abweichungen, die für Alzheimer eine Rolle spielen und damit für mögliche Ziele für innovative Therapien, haben die Bewohner einiger abgeschiedener Andendörfer im Nordwesten Kolumbiens geliefert: Unter ihnen – rund 25 Großfamilien sind betroffen – ist eine Genmutation verbreitet, die dazu führt, dass zahlreiche Bewohner bereits ab Mitte 30 an einer besonders rasch fortschreitenden und dramatisch verlaufenden Form von Alzheimer erkranken.
Zu wenig Pflegegeld für viele Betroffene
Ein wesentliches Problem gibt es für viele Alzheimer-Patienten bei der Pflegegeld-Einstufung. Hier lauert die Dissimulations-Falle, also das Untertreiben und Herunterspielen der tatsächlichen Beeinträchtigung. Es ist ein typischer Teil der Erkrankung, dass es Betroffenen gut gelingt, die Fassade aufrecht zu erhalten und ihren Zustand zu verbergen. Das tun sie dann allerdings auch im Kontakt mit Pflegestufen-Gutachtern, die mangels Spezialisierung dieses Phänomen nicht immer richtig einschätzen. Hier wären eine Sensibilisierung und entsprechende Schulungen erforderlich, damit die aktuell sehr restriktive Einstufungs-Praxis den tatsächlichen Betreuungs-Erfordernissen angepasst wird, die eine Alzheimer-Erkrankung mit sich bringt.
Das niedrige Pfleggeld geht auch auf Kosten der betreuenden Angehörigen, die so weniger Spielraum haben, Hilfe und Entlastung zu organisieren. 80 Prozent der Alzheimer-Betroffenen werden in Österreich zu Hause betreut – schon angesichts der hohen Kosten institutioneller Pflege eine erhebliche Entlastung der öffentlichen Sozialbudgets.
Was dabei oft übersehen wird: Betreuende Angehörige haben eine höhere Morbidität und Mortalität als Menschen ohne Betreuungsaufgaben. Daher ist ein deutlicher Ausbau von Betreuungs- und Beratungsangeboten dringend erforderlich, als materielles Zeichen einer höheren gesellschaftlichen Wertschätzung dieses unschätzbar wichtigen Beitrags. Nach dem Tod der kranken Angehörigen fallen Betreuende außerdem häufig in ein regelrechtes schwarzes Loch. Wichtig wäre es, wenn sie gerade in dieser Phase ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Selbsthilfegruppen weitergeben.
In Österreich sind derzeit geschätzte 100.000 Menschen an Morbus Alzheimer erkrankt, bis 2050 ist ein Anstieg auf 230.000 Betroffene prognostiziert.
(Bilder: Pixabay.com)




























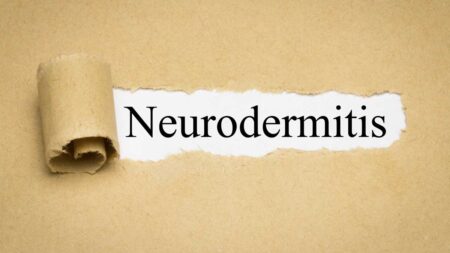



![Stimme fürs wertvolle Alter[n] – Pflege darf kein Pflegefall werden Eine Frau, die einer anderen mit Gehstock auf einer Treppe hilft. (c) AdobeStock](https://www.alterneudenken.com/wp-content/uploads/2023/05/pflegefall_home-450x253.jpg)














![Alter[n] und Pflege[n] neu gedacht – Was sagen Expert•innen dazu? Eine ältere Frau mit Brille, purpuren Lippen und Liedschatten und gelben Kopfhörern singt laut mit zur Musik, die sie hört. (c) AdobeStock](https://www.alterneudenken.com/wp-content/uploads/2022/10/alter-n-pflege-n_home-450x253.jpg)



