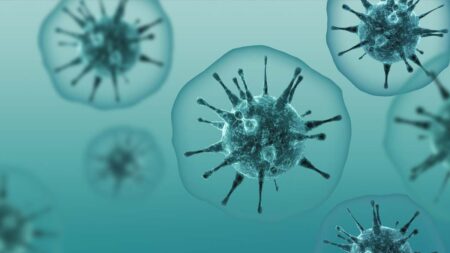Die präzise Therapiewahl bei Brustkrebs hängt entscheidend vom Status der Hormonrezeptoren für Östrogen und Progesteron ab. Deren konventionelle Bestimmung mittels Immunohistochemie [IHC] hat eine gewisse Fehlerrate, die durch Hinzunahme von Genomdaten gesenkt werden kann. Bereits die konventionelle Statistik liefert eine nennenswerte Verbesserung, doch nun können mittels Entscheidungstheorie vor allem widersprüchliche Befunde optimal vereinigt werden.
Das zeigt eine aktuelle Studie* der MedUni Wien unter Leitung von Wolfgang Schreiner vom CeMSIIS, Zentrum für Medizinische Statistik, Informatik und Intelligente Systeme. Die Methodik ist weit über Brustkrebs hinaus anwendbar, und kann überall, wo aus zahlreichen Befunden gleichzeitig Folgerungen zu ziehen sind – auch wenn die Befunde einander widersprechen – eingesetzt werden.
Brustkrebs und selbstfahrende Autos
Wem das nun [doch] ein wenig zu wissenschaftlich geklungen hat, hier eine bildhafte Erklärung: „Selbstfahrende Autos prüfen durch mehrere Sensoren, ob freie Fahrt möglich ist. Dabei kann einer der Sensoren ein Hindernis wahrnehmen und eine Notbremsung anfordern. Ein anderer Sensor mag in derselben Situation keine Gefahr erkennen. Was ist dann zu tun? Es gibt zwei mögliche Fehlentscheidungen, und jede ist auf andere Weise riskant: Wird nicht gebremst obwohl es nötig wäre, passiert ein möglicherweise schwerer Unfall. Bremst der Wagen unnötig, riskiert man einen Auffahrunfall des nachkommenden Fahrzeuges mit eventuell leichterem Schaden,“ so Schreiner.
Analog dazu ist die Situation bei der Therapiewahl für Brustkrebspatientinnen, die auf den Status der Hormonrezeptoren abgestimmt werden muss und darauf angewiesen sind.

Wenn sich Entscheidungsfaktoren widersprechen
Bei einer Patientin kann die IHC-Bestimmung „positiv“ ergeben, aber eine zweite Mess-Methode, etwa jene der Genexpression, ergibt „negativ“. Wieder gibt es zwei mögliche Fehlentscheidungen. Heinz Kölbl, Leiter der Klinischen Abteilung für Allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie [Universitätsklinik für Frauenheilkunde der MedUni Wien und Comprehensive Cancer Center von AKH Wien/ MedUni Wien]: „Gibt man nur die Hormontherapie, weil man eine Patientin fälschlicherweise für ‚positiv‘ hält – obwohl sie in Wirklichkeit ’negativ‘ ist – wird die lebensrettende Chemotherapie verabsäumt. Das wäre der maximale Schaden. Erhält umgekehrt eine ‚falsch negative‘ Patientin eine aggressive Chemotherapie anstelle der schonenderen Hormontherapie, erleidet sie unnötige Nebenwirkungen.“
Wie also sollte aus Sicht der Expertinnen und Experten bei widersprüchlichen Messergebnissen reagiert werden? „Genau dies ist die Stärke der Entscheidungstheorie,“ betont Schreiner. Anders als die konventionelle Statistik betrachtet diese nicht nur eine einzige Zahl, nämlich die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses [zum Beispiel ‚Rezeptor-positiv‘]), sondern auch die Wahrscheinlichkeiten für andere Möglichkeiten [‚möglicherweise Rezeptor-positiv‘, und ’sicher nicht Rezeptor-positiv‘ = ‚Rezeptor-negativ‘]. Diese umfassendere Sicht verbessert die Ergebnisqualität im Vergleich zur „gewöhnlichen“ Statistik, insbesondere wenn mehrere Befundquellen gleichzeitig relevant sind.
In einer sogenannten Big-Data Re-Use Studie wurde nun die Entscheidungstheorie erstmals in der Hormonrezeptor‑Diagnostik angewandt: Das Team vom CeMSIIS kooperierte dazu mit Heinz Kölbl, Christian Singer und Cacsire Castillo-Tong von der Klinischen Abteilung für Allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie der MedUni Wien. Von 3.753 Brustkrebs-Patientinnen wurden der Rezeptorstatus laut IHC sowie die gesamten Gen-Expressionsprofile erfasst und gemeinsam analysiert.
Entscheidungstheorie wirkt und warnt
In den Originalstudien wurden Therapien laut IHC-Rezeptorstatus gewählt. Bereits die konventionelle Statistik zeigte, dass Genomdaten in einigen Fällen den IHC-Befunden [Gold-Standard] zu widersprechen schienen. Genau an diesem Punkt wurde anstelle von konventioneller Statistik die Entscheidungstheorie angewandt, die aus widersprüchlichen Einzelbefunden in vielen Fällen einen präzisen Gesamtbefund erzeugen kann. Schreiner: „Die Entscheidungstheorie hat auch den Vorteil, dass sie ‘selbst merkt‘ wenn sie unsicher ist: Sie liefert dann dezidiert das Ergebnis ‚unentscheidbar‘. Auch dies ist eine wichtige Information, eine Warnung quasi.“
Dies passierte bei 153 Patientinnen und deutete darauf hin, dass aufgrund der IHC-Daten alleine möglicherweise suboptimale Therapieentscheidungen getroffen wurden. Tatsächlich zeigte diese [kleine] Patientengruppe ein signifikant schlechteres Überleben als die restliche, viel größere Gruppe mit bestätigtem IHC-Status und damit eigentlich „korrekt“ gewählten Therapien.
Die Wirksamkeit der Entscheidungstheorie wurde also an einem einfachen, aber klinisch hoch relevanten Beispiel für die Präzisionsmedizin demonstriert: „Die moderne Medizin nutzt zunehmend viele Informationsquellen, nicht zuletzt aus den Bereichen Labor, Intensivmedizin und Genomics. Evidenzen aus unterschiedlichen Quellen müssen zu Schlussfolgerungen vereinigt werden, bisher oftmals in SOPs [Anmerkung: Standard Operating Procedures] mit konventionellen ja/ nein-Entscheidungen oder auch intuitiv. Hier bietet die Entscheidungstheorie ein riesiges Feld an Verbesserungsmöglichkeiten.“

*Service: Scientific Reports
Details zu der Studie bzw. einen ausführlichen wissenschaftlichen Bericht können sie hier [in Englischer Sprache] nachlesen: „Decision theory for precision therapy of breast cancer.“ M. Kenn, C. Castillo-Tong, C. Singer, R. Karch, M. Cibena, H. Kölbl, W. Schreiner.
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82418-7. Sci Rep 11, 4233 (2021).
(Bilder: Pixabay.com (2x), MedUni Wien)