Diabetes betrifft grundsätzlich beide Geschlechter. Allerdings gibt es Geschlechtsunterschiede bei der Erkrankung und der Therapie. Auch wenn Frauen durchschnittlich etwas seltener von Diabetes betroffen sind, müssen sie bei einer bestehenden Erkrankung mit mehr Komplikationen und einer komplexeren Behandlung rechnen als Männer.
„Von Diabetes sind Frauen und Männer ungefähr gleich häufig betroffen, Männer um eine Spur häufiger. Trotzdem macht es Sinn, sich spezifisch mit dem Thema Frauen und Diabetes auseinanderzusetzen, denn Frauen sind von der Krankheit anders und teilweise schwerer betroffen“, erklärt Univ.-Prof.in Dr.in Alexandra Kautzky-Willer, von der Univ.-Klinik f. Innere Medizin III, Abtlg. f. Endokrinologie und Stoffwechsel, MedUni Wien und Präsidentin der Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG). „Sie verlieren mehr Lebensjahre und haben eine schlechtere Lebensqualität!“
Östrogen – ein Schutz auf Zeit
Frauen haben durch das Hormon Östrogen einen gewissen Schutz vor Typ-2-Diabetes. Bei ihnen setzt Fett weniger am Bauch an, sie haben eine höhere Insulinempfindlichkeit und sie haben im Durchschnitt einen niedrigeren Nüchternblutzucker und HbA1c-Wert (Langzeitblutzuckerwert). Sie erkranken oft erst in späteren Lebensjahren – hier spielt die Menopause und die damit einhergehende Abnahme des Östrogenspiegels eine Rolle. In den Wechseljahren nimmt der Anteil an adipösen Frauen aufgrund der hormonellen Umstellung und durch Bewegungsmangel stark zu. Damit steigt auch der Anteil der Frauen mit Typ-2-Diabetes. Eine frühe Menopause bedeutet ein zusätzlich erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes. Allerdings wird auch bei jüngeren Frauen vor allem durch Bewegungsmangel, Rauchen und Stress sowie damit assoziiert ungesunder Ernährung und Gewichtszunahme ein Anstieg beobachtet.

Ein Bauchumfang von mehr als 88cm gilt als erhöhtes Risiko. Betroffene Frauen sollten regelmäßig ihren Blutzucker, Blutfette und Blutdruck kontrollieren lassen und ihren Lebensstil anpassen. Ernährung und Bewegung sind dafür die Schlüssel. Gerade der Bewegungsmangel ist bei Frauen ein höherer Risikofaktor als bei Männern. Dafür kann eine Lebensstiländerung mit sportlicher Betätigung bei Frauen besonders gut vor Herz-Kreislauf-Komplikationen schützen. Aber auch am Beginn der Geschlechtsreife gibt es einen Risikofaktor: Eine frühe Menarche (erstes Eintreten der Regelblutung) bedeutet ein um 20 Prozent höheres Risiko für Typ-2-Diabetes.
Risikofaktor Nr. 1 für Frauen: Schwangerschaftsdiabetes
Der größte Risikofaktor für Frauen an Typ-2-Diabetes zu erkranken ist der Schwangerschaftsdiabetes. 50 bis 70 Prozent der Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes erkranken in den folgenden zehn bis 15 Jahren daran. Bei Müttern mit Schwangerschaftsdiabetes, die ein Mädchen geboren haben, ist dieses Risiko nochmals erhöht. Wobei aber das primäre Risiko einen Schwangerschaftsdiabetes zu bekommen höher ist, wenn Frauen mit einem Buben schwanger sind.
„Besonders wichtig für die weitere Risikoabschätzung ist der orale Glukosetoleranztest (OGTT) sechs bis zehn Wochen nach der Geburt, der auch zur Neubeurteilung der Glukosetoleranz basierend auf Studien und internationalen Guidelines notwendig ist. Diese Nachbeobachtung ist im Mutter-Kind-Pass nicht geregelt. Bisher wird meist nur direkt nach der Geburt der Blutzucker kontrolliert, was auch bei unauffälligen Werten nicht bedeutet, dass die Mutter kein höheres Diabetesrisiko hat. Die Compliance der frischgebackenen Mütter zur weiteren OGTT-Nachkontrolle ist in Österreich derzeit mit ungefähr 30 Prozent sehr schlecht. Die meisten Mütter kommen erst wieder nach Jahren mit einem manifesten Diabetes oder Komplikationen zum Arzt.
Eine gute Möglichkeit, um Mütter sechs bis zehn Wochen nach der Geburt zum Zuckerbelastungstest zu bringen, wäre eine Aufnahme dieser Untersuchung in den Mutter-Kind-Pass nach Schwangerschaftsdiabetes. Mit der Untersuchung nach diesem Zeitraum, wenn sich erste Routinen eingestellt haben und die akuten Geburtsbelastungen weggefallen sind, lassen sich das Risiko für einen auf den Gestationsdiabetes folgenden Typ-2-Diabetes abschätzen und die daraus folgenden notwendigen Präventions- oder Interventionsmaßnahmen gut ableiten“, erläutert Kautzky-Willer.
Neben dem Schwangerschaftsdiabetes gibt es einen weiteren Risikofaktor für Typ-2-Diabetes, der nur Frauen betrifft: Das Polyzystische Ovarsyndrom erhöht das Risiko um 20 bis 30 Prozent. Etwa zehn Prozent aller gebärfähigen Frauen bekommen ein Polyzystisches Ovarsyndrom. Hierbei haben die Frauen erhöhte männliche Sexualhormone, die zwar bei Männern schützend wirken aber bei Frauen ein erhöhtes Diabetes-Risiko mit sich bringen.
Herzinfarkt und Schlaganfall – bei Diabetes keine Männerdomäne
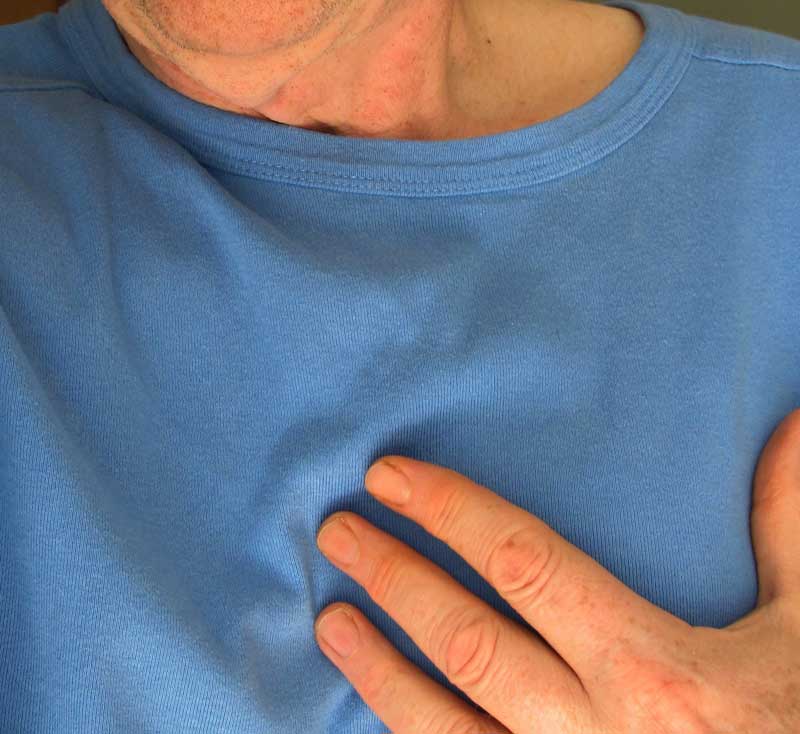
Gerade bei Frauen mit Diabetes sind vor der Menopause auch Herzerkrankungen ohne nachweisbaren Gefäßverschluss häufig, aufgrund von Durchblutungsstörungen der kleinsten Gefäße und Gefäßverkrampfungen. Obwohl neue Untersuchungen zeigen, dass aufgrund der besseren Behandlung die Sterblichkeit an Herz-Kreislauferkrankungen bei Diabetes im letzten Jahrzehnt sogar stärker rückläufig war als bei Nicht-Diabetikern, versterben noch immer ungefähr die Hälfte der Menschen mit Diabetes an Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche, Rhythmusstörungen oder anderen Gefäßkomplikationen.
Kautzky-Willer dazu: „Auffällig ist dabei, dass gerade Frauen und junge Menschen mit Diabetes weniger von den Fortschritten bei den Behandlungsmethoden profitiert haben. Insgesamt ist bei Frauen mit Diabetes das relative Risiko nach einem Herzinfarkt zu versterben auch höher als bei Männern mit Diabetes. Frauen mit Diabetes, die wegen einer Koronaren Herzkrankheit eine Stent-OP hatten, haben ein um 40 Prozent höheres Risiko, wieder ein koronares Ereignis zu haben. Männer haben „nur“ ein um 30 Prozent höheres Risiko. Das Risiko für Tod durch ein kardiovaskuläres Ereignis liegt bei Frauen mit Diabetes bei 30 Prozent, bei Männern mit Diabetes bei 15 Prozent wie eine aktuelle Studie unserer Abteilung in Kooperation mit dem Wilhelminenspital zeigte.“
Stress und Diabetes Distress – leider eine Frauendomäne
Psychosozialer Stress ist bei Frauen ein stärkerer Risikofaktor als bei Männern. Schlafmangel, Schichtarbeit, Doppelbelastung, niedriger Sozialstatus und schlechte Bildung sind Faktoren, die psychosozialen Stress und das Diabetesrisiko verstärken. Frauen sind auch häufiger von psychischen Problemen einschließlich Essstörungen als Komplikation rund um Diabetes betroffen, wodurch das Risiko für weitere Komplikationen steigt. Denn durch psychosozialen Stress liegen die Prioritäten anderswo. Der Diabetes wird vernachlässigt, die Einstellung der Therapie wird schlechter und die Behandlung durch zunehmende Insulinresistenz und vom Gehirn gesteuerte hormonelle Veränderungen schwieriger. Depressionen liegen bei Diabetes bei Frauen fast doppelt so häufig wie bei Männern vor, was die Prognose wiederum verschlechtert.
Diabetes ist zusätzlich eine Erkrankung mit relativ hohen organisatorischen Anforderungen. Die Betroffenen müssen oft mehrmals täglich Blutzucker messen, ihre Ernährung auf die Behandlung abstimmen und ausreichend Bewegung in ihren Alltag einbauen. Das ständige „Einhalten müssen“ dieser Anforderungen kann selbst zu einer emotionalen Überlastung führen – dem sogenannten Diabetes Distress. „Diabetes Distress führt wieder zu schlechterer Fürsorge für den eigenen Diabetes und dadurch zu schlechterer Stoffwechselkontrolle. Die Folge sind Akutkomplikationen bis hin zu chronischen Folgen mit mehr Spätschäden – je nach Dauer der Distress-Phase.

Diabetes-Therapie – Frauen haben es schwerer
Bei den verfügbaren Therapieoptionen bestehen für Frauen mit Diabetes höhere Risiken. SGLT2-Hemmer (blutzuckersenkende Antidiabetika, die eine verstärkte Ausscheidung von Glukose über den Harn bewirken) führen bei Frauen zu vermehrten Harnwegsinfekten und Pilzen. Diese Medikamente können auch zur gefährlichen Ketoazidose führen und davon sind wiederum Frauen häufiger betroffen. Allerdings profitieren Frauen auch besonders von ihren Vorteilen, wie Gewichtsabnahme, Verminderung der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit und weniger Unterzuckerungen.
Glitazone sind eine Gruppe von Wirkstoffen, die das Gewebe empfindlicher auf Insulin machen. Dadurch ist das körpereigene Insulin wieder in der Lage, erhöhte Blutzuckerspiegel zu senken. Bei Frauen steigt aber durch Glitazone auch das Risiko für Knochenbrüche.
Bei einer Insulintherapie bei Typ-2-Diabetes haben Frauen eine höhere Gefahr für Hypoglykämien – oft haben sie weniger Gewicht als Männer, die Dosierung ist bei ihnen schwieriger, es kommt leichter zu einer Unterzuckerung während des Schlafes.
Abschließend appelliert Kautzky-Willer: „Sowohl ÄrztInnen als auch Patientinnen brauchen ein erhöhtes Bewusstsein für die komplexeren Zusammenhänge und Risikofaktoren des Diabetes bei Frauen. Speziell nach einem Schwangerschaftsdiabetes muss die Untersuchungslücke geschlossen werden. Am wirksamsten wäre hier eine Untersuchung im Rahmen des Mutter-Kind-Passes.“
(Bilder v.o.n.u.: Pixabay.com, MedUniWien/ Mattern, Pixabay.com (2x))

