Aktuell steht der Nationale Aktionsplan Behinderung [NAP] für die Jahre 2022 bis 2030, zu dessen Umsetzung ein Inklusionsfonds unbedingt benötigt wird, vor seiner Fertigstellung. Der NAP wurde geschaffen, um die Umsetzung der von Österreich im Jahr 2008 ratifizierten UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen voranzutreiben und ist damit eine zentrale Leitlinie österreichischer Behindertenpolitik. Er soll konkrete Maßnahmen enthalten, um die Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in Österreich zu forcieren. Und obwohl die öffentliche Begutachtung noch bevor steht ist klar: Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif!
Inklusion darf nicht zu einer Frage der Finanzierung werden
Ob der Nationale Aktionsplan Behinderung 2022-2030 tatsächlich die Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderungen positiv verändern wird, hängt zu einem großen Teil davon ab, ob die im NAP festgeschriebenen Maßnahmen auch budgetär bedeckt sind und damit durchgeführt werden können. Es darf nämlich nicht vom Wohlwollen des oder der jeweiligen Finanzverantwortlichen abhängen, ob die von der Bundesregierung beschlossenen Vorhaben tatsächlich durchgeführt werden können oder nicht. Dazu ist eine klare Finanzierungszusage unbedingt vonnöten!
Der Österreichische Behindertenrat, BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, der Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich [BSVÖ], die Lebenshilfe Österreich, der Monitoringausschuss, SLIÖ – Selbstbestimmt Leben Österreich und der Behindertenanwalt fordern daher eine bedarfsgerechte Finanzierung der im Nationalen Aktionsplan Behinderung enthaltenen Maßnahmen.
Dafür ist, wie im Regierungsprogramm angedacht, die Einrichtung eines Inklusionsfonds zur Finanzierung von Maßnahmen, die in der Schnittstelle zwischen Bundes- und Landeskompetenz liegen, unbedingt erforderlich.
Die besten Maßnahmen greifen nur, wenn sie budgetär abgesichert sind
Der Inklusionsfonds soll, ähnlich dem Pflegefonds, aus finanziellen Mitteln des Bundes und der Länder gespeist werden und der Finanzierung individuell benötigter Leistungen mit dem Ziel einer umfassenden Teilhabe von Menschen mit Behinderungen dienen. „Beispiele dafür sind die Bereitstellung umfassender Persönlicher Assistenz für alle die sie benötigen, sowie die energische Intensivierung einer umfassenden De-Institutionalisierung,“ erläutert Behindertenanwalt Hansjörg Hofer.
„Die gleichberechtigte Teilhabe und Inklusion aller darf nicht zu einer Frage der Finanzierung werden. Mit dem NAP können wichtige Fortschritte erzielt werden – dafür ist die Finanzierungsfrage aber rechtzeitig und umfassend zu klären“, gibt Dr. Markus Wolf, Präsident des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Österreich zu bedenken.
„Besonders in jenen Bereichen, die sich resistent gegenüber der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen erwiesen haben, ist der NAP ein wichtiges Instrument. Die besten Maßnahmen greifen nur, wenn sie budgetär abgesichert sind. Das im Regierungsprogramm enthaltene Bekenntnis zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen darf kein Lippenbekenntnis sein, sondern muss eine entsprechende Finanzierung garantieren“, so Christine Steger, Vorsitzende des Unabhängigen Monitoringausschusses.
„Volle Inklusion und uneingeschränkte Teilhabe von 1,4 Millionen Menschen mit Behinderungen ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die nötigen Investitionen sind zu tätigen und werden sogar volkswirtschaftlichen Nutzen stiften. Selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen rechnet sich für alle,“ führt Michael Svoboda, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, an.
Inklusion darf nicht vor der digitalen Welt Halt machen
Der Zugang zu Kommunikations-Hilfsmitteln – man denke beispielsweise nur an Videokonferenz-Tools – ist für uns alle wichtiger geworden in Zeiten von „Physical Distancing“. Doch was für viele Menschen in Österreich glücklicherweise selbstverständlich ist: einen PC zu haben, Internet zu haben, Videokonferenzen nutzen zu können etc., ist für 63.000 Menschen in Österreich nicht selbstverständlich. Sie brauchen aufgrund ihrer Sprachbehinderungen „besondere“ technische Hilfsmittel.
Manche von ihnen brauchen zum Beispiel ein Gerät, das ihnen die Lautsprache – ihre „Stimme“ – ersetzt, sogenannte „Sprach-Ausgabegeräte“; manche brauchen „nur“ ein passendes PC-Eingabegerät, um über den PC mit anderen in Kontakt treten zu können. Deshalb fordern Diakonie und VERBUND gemeinsam seit über zehn Jahren einen Rechtsanspruch auf technische Hilfsmittel für Menschen mit Sprachbehinderungen. Doch dieser ist weiterhin ausständig.
„Immer noch fehlt in Österreich der Rechtsanspruch auf technische Sprach-Unterstützung. Das bedeutet für betroffene Kinder und Erwachsene, dass sie ihre dringendsten Bedürfnisse nicht äußern können. Auch Inklusion in Schule und Sozialleben bleibt ihnen verwehrt“. Mit diesen Worten erneuert Maria Katharina Moser, Diakonie Direktorin gemeinsam mit Kooperationspartner VERBUND die Forderung nach einem #RechtAufKommunikation. „Denn das Recht auf Kommunikation gilt für alle!“, betonen Diakonie Direktorin Moser und VERBUND CEO Michael Strugl gemeinsam.
Bis heute kein Rechtsanspruch und keine einheitliche Finanzierungshilfe
Bis heute gibt es weder einen Rechtsanspruch auf Assistierende Technologien, noch eine einheitliche Finanzierungshilfe für Betroffene. Und: die bürokratischen Hürden sind enorm. „Es braucht eine zentrale Anlaufstelle für Menschen, die Hilfsmittel benötigen. Die Situation ist in jedem Bundesland anders und sehr intransparent. Auch die Finanzierung muss endlich geregelt werden – denn Hilfsmittel sind teuer“, betont die Diakonie Direktorin.
Dass die Frage des Rechtsanspruchs noch immer nicht geklärt ist, und das nach über zehn Jahren, ist „sehr bedauerlich, denn erst ein Anspruch auf rechtlicher Basis verschafft Menschen die Sicherheit, dass alle, die Unterstützung benötigen, diese auch bekommen“, betont Moser. „Wenn Menschen mit Behinderungen Hilfsmittel brauchen, müssen sie einen Behörden-Dschungel durchqueren“, kritisiert sie. Die Antragsstellung ist kompliziert, unübersichtlich und langwierig. Denn bis heute sind bei Unterstützungsleistungen unterschiedliche Ämter und Institutionen von Bund und Länder involviert.
Die zentrale Anlaufstelle [One-Stop-Shop] wird seit Jahren versprochen. Im Mai 2021 wurde das Sozialministerium mit der Umsetzung von One-Stop-Shops beauftragt. Nun muss es an die Umsetzung gehen. Denn die Konzepte dafür liegen auf dem Tisch.

Modellvorbild Deutschland
In Deutschland zum Beispiel ist der Weg zum passenden Hilfsmittel transparent und verständlich geregelt. Zuerst wird der individuelle Bedarf erhoben, denn beim Hilfsmittel gibt es kein „one-size-fits-all“-Modell.
Auch die Evaluation des Hilfsmittels und gegebenenfalls eine Anpassung sind Teil des Prozesses. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse, denn es gibt einen Rechtsanspruch auf assistierende Technologien und Kommunikationsgeräte. Die Befürchtung, dass damit eine Kostenexplosion für die Kassen einhergeht, bewahrheitet sich nicht. Die Ausgaben für unterstützte Kommunikation machen in Deutschland nur 0,01 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben aus. Legt man das auf Österreich um, würde ein vergleichbares, flächendeckendes System rund 4,42 Millionen ausmachen.
Finanzielle Unterstützung ist Aufgabe der öffentlichen Hand
Dazu Michael Strugl: „Wir setzen uns nun seit mehr als zehn Jahren gemeinsam mit der Diakonie für den Rechtsanspruch auf Assistierende Technologien und Unterstützte Kommunikation ein. Ich denke, es ist an der Zeit, dass die Politik und die öffentliche Hand ihre Verantwortung übernehmen.“
Seit dem Jahr 2009 wurden durch den VERBUND-Empowerment Fund der Diakonie die individuelle Beratung von rund 6.000 Menschen mit Behinderung zur Unterstützten Kommunikation und Assistierenden Technologien ermöglicht. Parallel dazu wurden knapp 12.000 Pädagog•innen, Therapeut•innen und Angehörige in über 1.000 Workshops und Seminaren unter anderem zum Schwerpunktthema Frühförderung für Kinder mit Behinderung sensibilisiert und informiert.
(Bilder: AdobeStock, Diakonie, Diakonie/ Simon Rainsborough; Video: Youtube.com)





















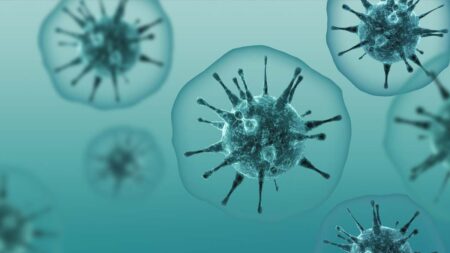










![Stimme fürs wertvolle Alter[n] – Pflege darf kein Pflegefall werden Eine Frau, die einer anderen mit Gehstock auf einer Treppe hilft. (c) AdobeStock](https://www.alterneudenken.com/wp-content/uploads/2023/05/pflegefall_home-450x253.jpg)









![Wie passen Künstliche Intelligenz [KI] und Energiesparen zusammen? Ein 3D-Modell eines Kopfes, dahinter Datenpunkte und Linien und die Hand einer Frau, die einen Punkt mit dem Finger verschiebt. (c) AdobeStock](https://www.alterneudenken.com/wp-content/uploads/2023/01/KI-energiesparen_home-450x253.jpg)










