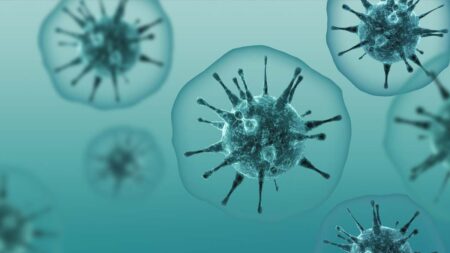Optimismus, positives Denken und Resilienz [der Prozess, in dem Menschen auf neue Herausforderungen und Veränderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren] sind ganz zentrale Instrumente für ein glückliches und gesundes Leben – nicht zuletzt in Zeiten der Pandemie. Denn so wie unser Immunsystem die körperliche Gesundheit schützt, kann eine positive Lebenseinstellung den Geist gegen psychische Krankheiten abschirmen. Und das beste daran: Optimismus und Resilienz lassen sich trainieren und stärken.
Heute war es schon nicht schlecht, aber morgen wird es besser
Optimismus ist eine Lebenseinstellung. Optimisten sehen ein halb volles und nicht ein halb leeres Glas. Optimisten sagen sich, dass es heute schon nicht schlecht war, aber morgen es [noch] besser wird. Optimisten finden in praktisch jeder Situation etwas Positives und gehen mit einem inneren Lächeln durch ein langes Leben.
Oder anders formuliert: unsere Gesundheit und somit letztlich auch unsere Lebensdauer hängen von unserer Befindlichkeit ab. Und in diesem Sinn kann man sagen: Nicht gesunder Pessimismus verlängert das Leben – sondern gesunder Optimismus. Denn mit einer negativen Lebenseinstellung machen wir uns das Leben nur unnötig schwer. Zugegeben, das sagt bzw. schreibt sich leichter als es getan ist. Und nicht immer ist in schwierigen Situationen gleich das viel zitierte „Licht am Ende des Tunnels“ erkennbar. Aber mit ein wenig Geduld kann man lernen, in jeder Situation den positiven und nicht den negativen Weg einzuschlagen.

Schwarzmalerei ist für den Körper so schädlich wie rauchen
Wer jeden Tag zweieinhalb Packungen Zigaretten raucht – das sind 50 Stück –, muss das schon ziemlich gerne tun. Was er oder sie wahrscheinlich nicht weiß ist die Tatsache, dass eine pessimistische Lebenseinstellung in etwa gleich ungesund ist. Beim Rauchen sagt uns das der [gesunde] Hausverstand, beim Pessimismus die Psychologie. Neueste Untersuchungen zeigen nämlich, dass chronische Schwarzmalerei, Hilflosigkeit, Depressionen oder eben Pessimismus für unseren Körper ungefähr gleich schädlich sind, wie eben 50 Zigaretten pro Tag. Und davon los zu kommen ist in beiden Fällen denkbar schwierig.
Das können [leider] auch gut 7,5 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher bestätigen. Denn so viele Menschen leiden laut Gesundheitsbefragung der Statistik Austria 2019 in unserem Land an der Volkskrankheit Depression. Dabei sind Frauen fast doppelt so stark betroffen wie Männer, Migranten eher als Einheimische.
Wie sehr nun der Pessimismus Anteil an diesen Zahlen hat, ist nicht untersucht. Mit Sicherheit kann man aber sagen, dass die Corona-Pandemie die Lage noch weiter verschlimmert hat. So haben etwa Studien des Departments für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit der Donau Universität Krems gezeigt, dass die psychischen Symptome für Depressionen, Ängste oder Schlafprobleme auf das Drei- bis Fünffache der Werte vor dem Ausbruch von Covid-19 angestiegen sind.
Diese Entwicklungen gehen umgekehrt einher mit sinkenden Zahlen beim Optimismus. Eine Umfrage des Linzer Market Instituts im Sommer 2020 hat ergeben, dass nur 35 Prozent der Österreicher•innen zuversichtlich in die nahe Zukunft blicken. So niedrig war die Zahl an Optimisten seit 2006 noch nie. Bis zur Flüchtlingskrise 2015 sahen sich die Befragten noch durchschnittlich zu 75 Prozent als Optimisten.
Risikofaktor Pessimismus
Dass Optimismus gesund für Körper und Geist ist, beweist sozusagen der Blickwinkel von der anderen Seite: Zahlreiche Untersuchungen und wissenschaftliche Publikationen zeigen nämlich, dass Pessimismus ein ernst zu nehmender Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Eine US-Amerikanische Studie mit fast 230.000 Patientinnen und Patienten fand heraus, dass Pessimisten ein höheres Risiko für Herzinfarkte oder Schlaganfälle in sich trügen. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass Optimisten eher zu Verhaltensweisen tendieren, die sich positiv auf Herz und Kreislauf auswirken, wie zum Beispiel regelmäßiger Sport oder bewusste Ernährung.
Aber auch in Sachen Sterblichkeit haben die Schwarzmaler messbare Nachteile, nämlich bis zu 15 Prozent weniger Lebensjahre! Auf diesen Wert kommt eine Studie von der Boston University School of Medicine, die den Gesundheitszustand und die Lebensführung von fast 70.000 Krankenschwestern untersucht hat. Besonders optimistische Teilnehmerinnen lebten der Auswertung zufolge im Durchschnitt um 15 Prozent länger als ihre besonders pessimistischen Kolleginnen.
Noch größere Differenzen zeigten sich in der Fragestellung, wie sich eine optimistische Lebenseinstellung auf die Chance auswirkt, 85 Jahre oder älter zu werden. Hierbei stellte sich heraus, dass besonders optimistische Frauen eine um 50 Prozent höhere Chance hätten, ein hohes Alter zu erreichen, als jene, die in entsprechenden Befragungen besonders pessimistische Ansichten an den Tag gelegt haben.
Diese Erkenntnis belegt auch die inzwischen legendäre „Nonnen-Studie“ aus den 1930er Jahren. Im September 1930 hatte die amerikanische Oberin eines Ordens ihren Nonnen dazu aufgefordert, ihr bisheriges Leben in ungefähr 300 Wörtern, inklusive Geburtsort, Eltern, Schulbildung und interessanten Erlebnissen der Kindheit zusammenzufassen. Wissenschaftler•innen durchforsteten diese handgeschriebenen Autobiografien in der Folge nach bestimmten Schlüsselwörtern, die entweder eine positive, negative oder neutrale Emotion zum Ausdruck brachten. Aus etwa 90.000 unterschiedlichen Wörtern filterten sie 1.598 heraus, die eine Emotion ausdrückten. 84 Prozent davon waren positiv, 14 Prozent negativ, der Rest neutral. Anschließend wurde analysiert, welche Nonnen noch lebten beziehungsweise in welchem Alter sie gestorben waren.
Jene Gruppe, die am wenigsten positive Wörter benutzt hatte, wurde im Schnitt 86,6 Jahre alt. Jene Schwestern, die die meisten positiven Wörter benutzt hatten, waren im Schnitt 93,5 Jahre alt geworden. Ein Unterschied von knapp sieben Jahren! Mehr noch: Die Wahrscheinlichkeit, mit 90 bereits gestorben zu sein, lag bei der positiv gestimmten Gruppe bei 38 Prozent – und bei der negativ gestimmten Gruppe bei 70 Prozent.
Optimismus mit Hilfe von konstruktiver Interpretation lernen
Alle Optimisten werden sich jetzt natürlich freuen – und weiterhin optimistisch ihren Weg gehen. Aber auch allen Pessimisten sei versichert: Die Rollen von Pessimisten und Optimisten sind nicht[!] unumstößlich verteilt. Oder anders gesagt: Optimismus sei erlernbar!
Pessimisten gehen sehr oft davon aus, dass sie an ihrer eigenen, als negativ empfundenen Lebenssituation nichts ändern können und selbst dafür verantwortlich zu sein. Diese pessimistische Einstellung führt sehr oft zu Depressionen, weil negative Erfahrungen ständig auf das eigene Verhalten oder Verschulden zurückgeführt werden. Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, muss man versuchen, eingefahrene destruktive Denkmuster durch konstruktive Interpretationen zu ersetzen – und genau dieses Verhalten lässt sich trainieren. In diesem Sinn geht es nicht darum, zu korrigieren, was falsch ist – es geht darum, aufzubauen, was richtig ist.
Die sogenannte „Positive Psychologie“ beschäftigt sich mit begünstigenden Eigenschaften und Bedingungen des Wohlbefindens. Statt zu fragen, was im Leben falsch läuft, schaut sie auf das, was besonders gut läuft. Denn lediglich zehn Prozent des eigenen Glücksempfindens hänge von äußeren Faktoren ab. Der überwiegende Teil wird vom eigenen Denken und Handeln bestimmt. Und hier kommt nun die sogenannte Resilienz ins Spiel
Die eigene psychische Gesundheit aufrechterhalten
Resilienz bedeutet in der Psychologie, die Fähigkeit, die eigene psychische Gesundheit auch unter belastenden Situationen aufrechtzuerhalten. Die geistige Widerstandskraft setzt sich dabei aus unterschiedlichen Fähigkeiten wie zum Beispiel Selbstbewusstsein, Charakterstärke oder eben auch Optimismus zusammen.
Bereits im Jahr 1955 begann die US-Psychologin Emmy Werner mit einer Langzeitstudie, die heute noch als wegweisend für die Resilienzforschung gilt. Darin begleitete sie das Aufwachsen von 700 hawaiianischen Kindern, ein Drittel davon in besonders prekären Verhältnissen. Hunger, Vernachlässigung oder Misshandlung prägten den Start der Kinder ins Leben. Nach drei Jahrzehnten Beobachtung stellte Werner fest, dass aus dieser Gruppe wiederum ein Drittel unbeschadet hervorgegangen ist, sprich sie ließen sich nicht unterkriegen und waren aller Widrigkeiten zum Trotz in der Lage, ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen.
Werner erklärte die Resilienz dieser Kinder mit einer besonderen Bezugsperson, die ihnen in schwierigen Situationen Halt gab – ein Mensch, der ihnen zur Seite stand und das Gefühl gab, etwas wert zu sein. Eine verlässliche Bezugsperson in der Kindheit gilt als zentraler Faktor für die psychische Widerstandsfähigkeit.
Resilienz kann allerdings auch ins Negative übersteigert werden, etwa wenn zu viel Verantwortung auf den Einzelnen abgeschoben wird. Sich ständig einzureden, man müsse widerstandsfähiger werden, noch mehr aus sich herausholen, das ist nicht im Sinn der Sache. Stattdessen sollte man gut auf sich selbst achten, seine Stärken gut einsetzen und weiterentwickeln. Letztlich ist Resilienz auch ein gesamtgesellschaftliches Konzept, in dem auch Wirtschaft und Politik eine Rolle spielen – indem sie ein Lebensumfeld ermöglichen, in dem alle Menschen ihr positives Potenzial entfalten können.

Eine „Alles wird gut“-Einstellung alleine führt nicht zum Ziel
Die Pandemie hat unheimlich viele Missstände aufgedeckt wie beispielsweise katastrophale Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen oder in der Textilindustrie. Auch die klimatischen Zusammenhänge wurden anhand des abnehmenden Flugverkehrs deutlich. Der springende Punkt dabei ist, was die Welt daraus lernen kann. Optimismus als „Alles wird gut“-Einstellung lässt sich damit nicht in Einklang bringen. Weise Menschen hingegen haben gelernt, dass vieles im Leben sich nicht automatisch zum Guten wendet und auch nicht steuerbar ist. Weise Menschen haben aber auch gelernt, dass sie Probleme bewältigen können. Sie vertrauen in ihre grundsätzliche Fähigkeit, mit Unsicherheiten umzugehen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch das sogenannte „posttraumatische Wachstum„. Es lässt sich beobachten, wenn Menschen nach existenziellen gesundheitlichen Bedrohungen, Unfällen oder Naturkatastrophen über sich hinauswachsen. Nach schweren traumatischen Erfahrungen sagen Betroffene oft, dass sie danach engere Beziehungen zu anderen Menschen aufgebaut haben oder ihre eigene Stärke entdeckt hätten. Leute, die in einem Stressberuf einen Herzinfarkt erlitten haben, kommen zur Erkenntnis, dass sie so nicht mehr weiterleben wollen. Schwerwiegende Ereignisse können also positive Folgen mit sich bringen. Dafür ist es aber erforderlich, sich selbstkritisch mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen.
(Bilder v.o.n.u.: AdobeStock (2x), Pixabay.com, AdobeStock)







![4 Erfolgshaltungen führen zum [Online-]Dating-Erfolg Grafik: Zwei Handyscreens mit einer Frau und einem Mann, dazwischen fliegende Herzen. (c) AdobeStock](https://www.alterneudenken.com/wp-content/uploads/2024/10/online-dating-erfolg_home-450x253.jpg)







![Zukunftsvisionen: Vielfältige Einsatzgebiete von Künstlicher Intelligenz [KI] in den kommenden Jahren Ein menschlich anmutender Roboter, der ein großes virtuelles Touchpad bedient. (c) AdobeStock](https://www.alterneudenken.com/wp-content/uploads/2024/09/ki-zukunft_home-450x253.jpg)